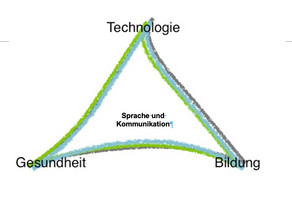Praktikumsleitfaden (außerschulisch, B.A.)
Leitfaden zur Erstellung des Praktikumsberichts im Studiengang Rehabilitationspädagogik (B.A.) im Studienschwerpunkt Sprachtherapie (2. Praxisphase)
Allgemeines
- Bitte reichen Sie den Bericht vier Wochen nach Beendigung des Praktikums im Sekretariat "Sprache und Kommunikation" bei Sandra Szczecina (R. 5.434) ein oder senden Sie ihn per E-Mail (als Anhang in pdf) an sandra.szczecina@tu-dortmund.de.
- Der Bericht wird von N.N. des Fachgebiets Sprache und Kommunikation gelesen und beurteilt. Sie erhalten per E-Mail Nachricht, wann Sie Ihren Bericht persönlich abholen und Ihr geleistetes Praktikum auf Ihrem (mitgebrachten) Schein bestätigen lassen können.
- Die folgenden Vorgaben zur Erstellung des Praktikumsberichtes sind als Checkliste gedacht. Nutzen Sie darüber hinaus die Möglichkeit, persönlich relevante Aspekte aus Ihrem Praktikum zu fokussieren und Ihren Bericht individuell zu gestalten.
Formale Vorgaben
- Ihr Bericht hat einen Umfang von mindestens 15 und maximal 25 Seiten.
- Für die formale Anfertigung Ihres Praktikumsberichtes halten Sie sich an den vom Fachgebiet Sprache und Kommunikation erstellten "Leitfaden zur Erstellung von Qualifikationsarbeiten".
- Achten Sie unbedingt auf die Anonymisierung verwendeter Daten!
Interviews, Fotos, verwendete Therapie-Materialien etc. sind zur Illustration erwünscht, unterliegen aber dem Datenschutz. Holen Sie hierfür die Einverständniserklärung von den Klientinnen bzw. der Leiterin der Einrichtung und fügen Sie diese in den Anhang Ihres Berichtes ein. - Sämtliche Informationsquellen, auf die Sie sich in Ihrem Bericht beziehen, auch anonymisierte Gutachten, Interviews etc. müssen sowohl im Text als auch im Literaturverzeichnis angeben werden.
Inhaltlicher Aufbau
1. Einleitung
- Formulieren Sie Ihre Erwartungen an das Praktikum (z.B. eigener Einsatz innerhalb des Praktikums).
- Erläutern Sie den Aufbau Ihres Berichtes (Aufbau, Bezüge zum Leitfaden, Schwerpunkte etc.)
2. Strukturelle und inhaltliche Aspekte der Arbeit in der Einrichtung
- Zeitraum des Praktikums
- Art, Lage, Einzugsgebiet, Größe, Struktur und Geschichte der Einrichtung
- Trägerschaft und Finanzierung
- personelle, räumliche und materielle Ausstattung
- Organisationsrahmen der Teamarbeit
- interne und externe Kooperationen/ Vernetzung
- Bereitstellung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen/Supervision
- Tagesabläufe und „Routinen“
- Beschreibung der Klientel (besondere Schwerpunkte?)
- Therapie- und Förderansätze/Gruppen- oder Einzelförderung
- Eltern- und Angehörigenarbeit
- besondere Angebote der Einrichtung
3. Spezifische fachliche Arbeit anhand von einem Fallbeispiel
- Charakterisieren Sie das Störungsbild unter Einbezug einschlägiger Fachliteratur (Begriffsklärung, Erscheinungsbild etc.).
- Beschreiben Sie bitte die Ausgangslage (Anamnese, Biographie, Bedingungshintergrund, Beeinträchtigungen, aktuelle Therapieinhalte und Ressourcen in den Entwicklungsbereichen: Wahrnehmung, Motorik, Kognition, Sprache/Kommunikation, soziales und emotionales Verhalten, etc.)
- Verfassen Sie für das Fallbeispiel ein Beobachtungsprotokoll (einschließlich einer Zusammenfassung) von einer Therapieeinheit. (Details werden im Vorbereitungsseminar erarbeitet.) Alternativ zum Beobachtungsprotokoll können Sie ein Transskript und eine Spontansprachanalyse (bei SES) eines 10-minütigen Therapieausschnitts mit mindestens 30 Äußerungen erstellen.
- Dokumentieren Sie darauf aufbauend für dasselbe Fallbeispiel eine selbst unter Anleitung durchgeführte Therapieeinheit inkl. Planung, Verlauf/Durchführung & Reflexion. (Details werden im Vorbereitungsseminar erarbeitet.)
- Analyse der Beziehungsebene: „Das Kind/der Jugendliche/der Erwachsene und ich.“
4. Gesamtreflexion
- Reflektieren Sie den Verlauf des Praktikums (eigene Tätigkeiten, Betreuung, Einarbeitung, Feedback durch die Einrichtung, etc.)
- Kam es zu einer Veränderung der eigenen Vorstellungen und Erwartungen durch das Praktikum?
- Dokumentieren Sie Ihren Erfahrungs- und Erkenntnisgewinn durch das Praktikum (Bedeutung des Praktikums für das Studium/spätere Berufstätigkeit, offene und weiterführende Fragen etc.)
- Formulieren Sie ein „Schlussblitzlicht“ (Was hat mir am besten/weniger gut gefallen? Mein Wunsch für die Zukunft.)
Literatur
Anhang
z. B. verwendete Therapiematerialien, anonymisierte Fotos, anonymisierte Gutachten, etc.